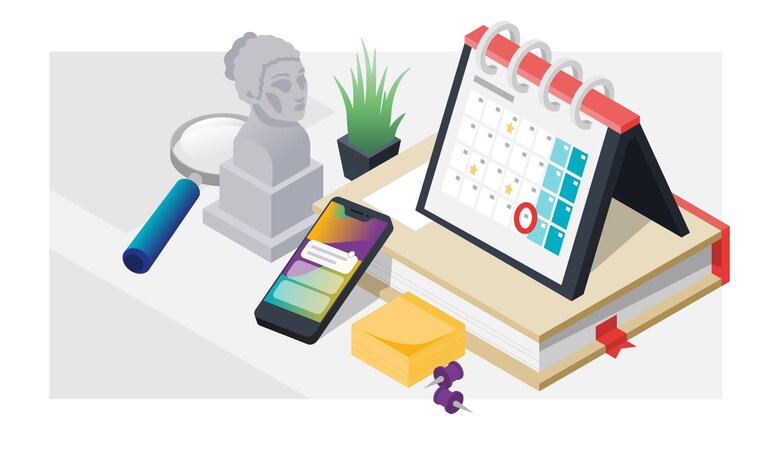Polizei
Forscher zu Polizeigewalt: «Fängt nicht beim Schießen an»
Forscher zu Polizeigewalt: «Fängt nicht beim Schießen an»
Forscher zu Polizeigewalt: «Fängt nicht beim Schießen an»

Diesen Artikel vorlesen lassen.
Nicht immer werden Polizisten als Freunde und Helfer empfunden. Eskalation bei Einsätzen und Vorwürfe überzogener Gewalt lösen immer wieder Kontroversen aus.
Wenn Polizisten Gewalt ausüben, kann das als letztes Mittel mit einem Einsatz zusammenhängen. Doch es gibt auch immer wieder Vorwürfe nach Vorfällen, bei denen der Einsatz von Gewalt überzogen oder gar unprovoziert erscheint. Im August vergangenen Jahres etwa löste der Fall eines 16-Jährigen eine große öffentliche Debatte aus, nachdem der Jugendliche in Dortmund von Polizeibeamten mit einer Maschinenpistole bei einem Einsatz erschossen worden war.
Hat die Polizei ein Gewaltproblem? Und wie ist Gewalt überhaupt zu definieren? Einigen dieser Fragen ist der Polizeiforscher Tobias Singelnstein in seinem neuen Buch nachgegangen. Der Jurist, der an der Frankfurter Goethe Universität lehrt und forscht, sprach dazu mit Betroffenen von Polizeigewalt ebenso wie mit Polizisten, Führungskräften der Polizei und internen Ermittlern, die sich mit der Aufklärung von Gewaltvorwürfen in den eigenen Reihen befassen.
Forscher: Gewalt «nur ausnahmsweise einsetzen»
«Die Gewalt fängt nicht erst beim Schießen an, sondern eigentlich schon bei einfachen Überwältigungshandlungen», sagte Singelnstein der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse sich klar machen: «Für Leute, die von diesem Gewalteinsatz betroffen sind, ist es immer eine relativ drastische Erfahrung – auch wenn jemand nur mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wird und auch wenn das rechtmäßig erfolgt.»
Zwar hat die Polizei aufgrund ihrer Aufgaben ein Gewaltmonopol - doch auch die Beamten dürften Gewalt «nur ausnahmsweise einsetzen» sagte Singelnstein. «Auf der anderen Seite sehen wir, dass es innerhalb der Polizei eine gewisse Normalisierung der Gewalt gibt, weil es für die Beamten zu ihrem beruflichen Alltag gehört.»
So hätten sich aus dem gesammelten Material Hinweise darauf ergeben, dass Abschiebungen sowie Kontrollsituationen in sogenannten
Gefahrengebieten ein erhöhtes Konfliktpotenzial und Risiko polizeilicher Gewaltanwendungen bergen, heißt es in dem Buch.
Zugleich wird betont: Die Grenzen zwischen angemessener und übermäßiger polizeilicher Gewalt seien fließend und nicht immer leicht zu ziehen, auch wenn es mitunter klar zu beurteilende Fälle gebe.
Situationen, in denen ein Gewalteinsatz stattfinde, seien komplexe und häufig sehr dynamische Geschehensabläufe, fanden Singelnstein und sein Team bei ihren Untersuchungen heraus. Man kenne das aus «normalen» Konfrontationen, in denen ein Wort das andere ergebe, oder eine Handlung Reaktionen erzeuge.
Erhöhte Sensibilität für das Thema
Für Bürgerinnen und Bürger sei dabei relativ schnell die Schwelle zur Strafbarkeit überschritten - auch passive Haltungen könnten bei Demonstrationen und Räumungen wie Anfang des Jahres im Fechenheimer Wald bei Frankfurt als Widerstandshandlungen gewertet werden und zu Anzeige und Strafverfahren führen.
«Es gibt keine dramatische Zuspitzung in dem Bereich», so Singelnstein zu Fällen von Polizeigewalt. «Im Vergleich etwa zu Demonstrationsgeschehen in den 1980er Jahren sind wir heute auf einem wirklich ganz anderen Level der Gewalt bei Auseinandersetzungen zwischen Bürgern und der Polizei. Allerdings sind wir heute als Gesellschaft viel sensibler gegenüber Gewalterscheinungen und auch für polizeiliche Gewaltausübungen gilt ein anderer Rechtfertigungsbedarf.»
Ähnlich sehen es Polizeigewerkschafter: Ermittlungen im eigenen Bereich gebe es in den vergangenen Jahren häufiger, sagt der Geschäftsführer der Polizeigewerkschaft in Hessen, Alexander Glunz. Doch die Zahl der tatsächlichen Verurteilungen sei dagegen niedrig geblieben. «Natürlich sehen wir die Vorbildfunktion der Polizei und erlauben daher keine Rechtsbrecher in den eigenen Reihen», sagt Glunz.
Daher werde für jeden Vorwurf eine lückenlose Aufklärung gefordert. Es zeige sich aber auch, wie Glunz weiter ausführt, dass sehr viele Verfahren wieder eingestellt würden, da entweder die Unschuld oder kein ausreichender Tatverdacht vorliege.
Singelnstein beklagt, dass es in Deutschland nicht wie in anderen Ländern transparent statistisch erfasst wird, wie häufig und in welcher Form die Polizei in Deutschland Gewalt ausübt oder wie häufig Menschen im Kontext von Polizeieinsätzen zu Tode kommen. «So eine Datenbasis, so eine statistische Erfassung wäre schon mal ein erster wichtiger Schritt.»
Bedeutung der Kommunikation
Hinzu komme, dass in den Gesetzen nicht explizit stehe, welche «einfache körperliche Gewalt» Polizisten erlaubt sei. «Aktuell wird sehr intensiv über Schmerzgriffe diskutiert und man sieht, dass die verschiedenen Polizeien in den verschiedenen Ländern da unterschiedliche Linien haben», nennt der Wissenschaftler ein Beispiel. «Manche sagen, wir wenden gar keine Schmerzgriffe an, andere haben das sehr stark in die Praxis übernommen.»
Doch abgesehen von Gesetzesregeln und Transparenz: Damit es gar nicht erst zu einer Eskalation und Gewalt komme, sei Kommunikation sehr wichtig. «Es gibt Beamte, die können das sehr gut, die haben eine sehr starke soziale Kompetenz, solche Situationen im Einsatz zu klären und zu deeskalieren», sagt Singelnstein. «Und es gibt Menschen, die können es einfach nicht so gut - und da funktioniert es dann vielleicht in der Praxis auch einfach nicht so gut.»
Der Polizeiforscher meint daher, dass Kommunikation in der Ausbildung von Polizeibeamten eine noch viel größere Rolle spielen sollte. «Und es wäre wichtig, die Resilienz zu trainieren, mit einer Infragestellung von polizeilicher Praxis durch Bürger in Einsatzsituationen umzugehen.» Denn längst nicht alle Polizisten kämen damit klar, dass Bürger ihre Anordnungen in Frage stellten und erst einmal diskutieren wollten.