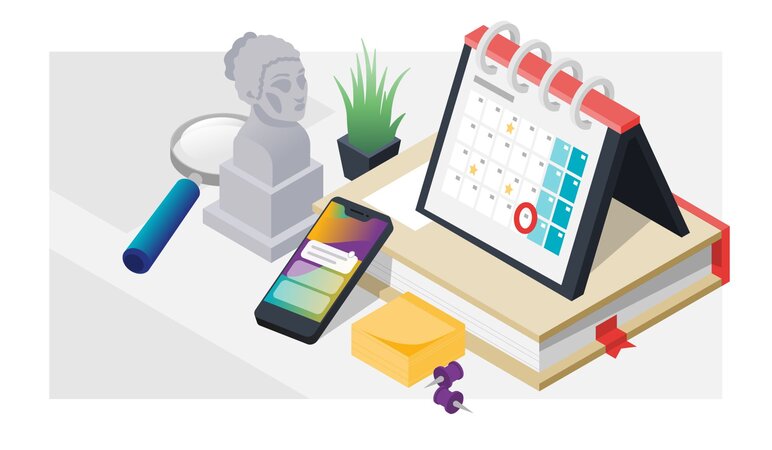US-Außenpolitik
Unruhen in der Karibik sind Drahtseilakt für Biden
Unruhen in der Karibik sind Drahtseilakt für Biden
Unruhen in der Karibik sind Drahtseilakt für Biden

Diesen Artikel vorlesen lassen.
Einmischen oder raushalten? Die Unruhen in Kuba und Haiti setzen US-Präsident Biden unter Druck. Der ist plötzlich mit zwei politischen Krisen in direkter Nachbarschaft konfrontiert.
«Close to home» nennt man im Englischen etwas, das einen direkt betrifft. «Close to home» sind für US-Präsident Joe Biden in doppelter Hinsicht die jüngst ausgebrochenen Krisen in den Karibikstaaten Kuba und Haiti.
Beide Länder sind zum einen schlicht geografisch den USA sehr nah. Und weil sie in Amerikas sprichwörtlichem Hinterhof, also dessen traditionellem Einflussgebiet liegen, betreffen die Ereignisse dort auch die USA.
Sowohl zum Chaos in Haiti nach der Ermordung des Präsidenten als auch zu den seltenen Massenprotesten in Kuba gegen die autoritäre Regierung muss sich der US-Präsident irgendwie verhalten. Helfen, ja oder nein? Und wenn ja, wie nur?
Haiti und Kuba stellen für Biden ein Dilemma dar, in dem er viel falsch und wenig richtig machen kann. Und die Haltungen der Regierungen der beiden Nachbarn zu einem möglichen Eingreifen der USA könnten kaum verschiedener sein.
Hilferuf aus Haiti
Eigentlich spielt die außenpolitische Musik der USA gerade ganz woanders - viel weiter weg. Da ist vor allem der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan, der Amerika beschäftigt. Das Ende des Einsatzes hat Biden den Menschen im Land gerade erst in einer Rede erklärt. Nur einen Tag vorher wurde Jovenel Moïse in seiner Residenz bei Port-au-Prince erschossen. Ein haitianischer Arzt, der in den USA lebt, soll den Mord durch kolumbianische Söldner in Auftrag gegeben haben, um selbst Präsident seines armen Heimatlandes zu werden.
Die haitianische Regierung hat um Hilfe gerufen - und die ehemalige Besatzungsmacht USA gebeten, Truppen zu schicken. Doch US-Truppen in Haiti - das hat schon in der Vergangenheit die Lage nicht verbessert, vielleicht gar verschlimmert.
«Wenn Haiti einfach leise in der Karibik versinken oder 300 Fuß in die Höhe steigen würde, wäre das für unsere Interessen ziemlich egal», sagte Biden in einem TV-Interview 1994 - damals war er noch Senator von Delaware. Diese Gleichgültigkeit kann sich der 78-jährige Demokrat gegenüber dem Staat, der nur gut 1000 Kilometer von Florida entfernt liegt, heute nicht mehr erlauben.
Haiti, das ärmste Land des amerikanischen Kontinents, droht angesichts von politischem Chaos und Bandengewalt, noch tiefer in eine humanitäre Krise zu versinken. Aber ein großer Teil der haitianischen Bevölkerung will trotz der prekären Lage keine ausländische Einmischung mehr.
Schwere Vorwürfe gegen Blauhelme
Nach der zuvor letzten Ermordung eines amtierenden haitianischen Präsidenten im Jahr 1915 hatten die USA 19 Jahre lang Haiti besetzt. Auch nach einem Putsch 2004 kamen US-Soldaten, gemeinsam mit UN-Friedenstruppen, um die Lage zu beruhigen. Die Blauhelme der UN-Stabilisierungsmission Minustah lösten einen Cholera-Ausbruch aus und wurden zahlreicher Sexualverbrechen beschuldigt. Auch von dem vielen Geld, das nach dem verheerenden Erdbeben 2010 für den Wiederaufbau aus dem Ausland zugesagt wurde, sahen durchschnittliche Haitianer nur wenig.
«Viele Leute wollen wegen der Vergangenheit keine neue Invasion Haitis», sagt der haitianische Journalist Widlore Mérancourt im Podcast «Pod Save the World». Man muss gar nicht weit in die Vergangenheit gehen. Der unbeliebte Moïse war nach Meinung vieler überhaupt nur noch an der Macht, weil ihn die USA unterstützten - trotz Vorwürfen der Korruption und der Beziehungen zu Banden.
«Es ist an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft sich hinsetzt und der Zivilgesellschaft zuhört», zitiert Mérancourt einen Anwalt, mit dem er gesprochen hat, und der stellvertretend für viele sprach.
Biden hat nun auch klargestellt: «Die Idee, amerikanische Truppen nach Haiti zu schicken, steht derzeit nicht auf der Tagesordnung.» Sollte Haiti weiter ins Unglück stürzen, muss Biden aber damit rechnen, dass dafür die USA mitverantwortlich gemacht werden.
Jede US-Äußerung gilt als Beweis für Einmischung
Auch in Kuba - das sogar nur 150 Kilometer entfernt ist - müssen die USA einen Drahtseilakt vollführen. Die Schweinebucht und andere Versuche der USA, die Regierung von Fidel Castro im Kalten Krieg zu stürzen, sind dort nicht in Vergessenheit geraten. Jede Äußerung und jede Geste - so gut sie auch gemeint sein mag - wird von der Regierung als Beweis für US-Einmischung angeführt. Die Führung der Kommunistischen Partei Kubas - der einzigen dort zugelassenen Partei - stellt die Demonstranten ohnehin als Unruhestifter dar, die von den USA bezahlt worden seien, um die kubanische Gesellschaft zu spalten.
Der sprichwörtliche Elefant im Raum ist das Embargo der USA gegen Kuba. Die USA hatten zunächst 1958 ein Waffenembargo gegen Kuba erlassen. Als nach der Revolution von 1959 Eigentum von US-Firmen verstaatlicht wurde, kamen ab 1960 immer mehr Handelsbeschränkungen hinzu. Jedes Jahr verurteilt die UN-Vollversammlung das Embargo fast einstimmig. Wenn sich Biden wirklich um das Wohlergehen der Kubaner sorge, sagt Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel diese Tage immer wieder, dann würde er die US-Blockade Kubas beenden. Das Embargo kann vollständig nur vom US-Kongress aufgehoben werden.
Kubanische Regierungsgegner betonen, ihr Protest richte sich gegen die Unterdrückung und Mangelwirtschaft der «Diktatur», nicht gegen die Auswirkungen des Embargos. «Die USA haben damit gar nichts zu tun», sagt etwa die Youtuberin Dina Stars im spanischen TV-Sender Cuatro, kurz bevor sie bei laufendem Interview festgenommen wird.
Es gibt Stimmen in den USA - etwa die der einflussreichen linken Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez - die eine Aufhebung des Embargos fordern. Dass sich viele Demokraten im Kongress dafür einsetzen, ist aber mit Blick auf die Wahlaussichten der Partei in Florida, wo viele Exil-Kubaner leben, sehr unwahrscheinlich. Es gibt allerdings auch andere Möglichkeiten, den Kubanern zu helfen - die US-Regierung könnte etwa Beschränkungen für Geldsendungen auf die Insel aufheben, die im vergangenen Jahr in Kraft traten - viele Kubaner sind auf Geldtransfers ihrer Verwandten angewiesen. Das hat Biden aber vorerst ausgeschlossen.
Der Kuba-Konflikt hat die USA bereits erreicht
Biden hatte während seiner Präsidentschaftskampagne angekündigt, solche Sanktionen des damaligen US-Präsidenten Donald Trump gegen Kuba zurückzunehmen und zur Annäherung unter dessen Vorgänger Barack Obama zurückzukehren - passiert ist bis heute nichts. «Eine Änderung der Kuba-Politik (...) gehört derzeit nicht zu den obersten außenpolitischen Prioritäten des Präsidenten», sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, noch im April. Das dürfte sich nun geändert haben.
Auch weil der Konflikt die USA bereits erreicht hat. Exil-Kubaner haben in der vergangenen Woche unter anderem in Florida protestiert und Highways blockiert. Sie fordern, dass Biden die Demonstrierenden in Kuba unterstützt. Kuba sei ein «gescheiterter Staat» und Kommunismus ein «gescheitertes System», sagte Biden jüngst. Doch was bedeutet das nun im Umgang mit der Krise, in der Biden von mehreren Seiten unter Druck gesetzt wird?
«Progressive sollten verstehen, dass nichts im Entferntesten "progressiv" an der brutalen, unterdrückerischen, neostalinistischen Regierung Kubas ist», schrieb die «Washington Post» zuletzt in einem Kommentar. «Und die Konservativen sollten verstehen, dass sechs Jahrzehnte Embargos, Sanktionen und unerbittliche Feindseligkeit ein völliger, düsterer, kontraproduktiver Misserfolg gewesen sind.» Solidarisch mit dem kubanischen Volk zu sein, würde Díaz-Canel viel mehr erschrecken als irgendwelche neuen Sanktionen.
Erste Schritte in Richtung Solidarität hat Biden bereits gemacht - wenn auch bisher, ohne klar zur Tat zu schreiten. Er hat sich offen gezeigt, Corona-Impfstoff nach Kuba zu schicken - unter Bedingungen. Und er wolle schauen, ob die USA das dort von der Regierung blockierte Internet irgendwie wieder zum Laufen bringen könnten, sagt Biden. Man prüfe aber erstmal, wie das überhaupt gehen könne.